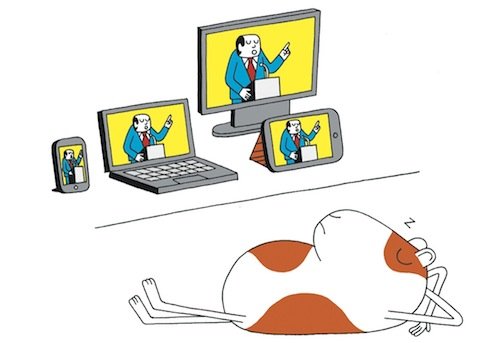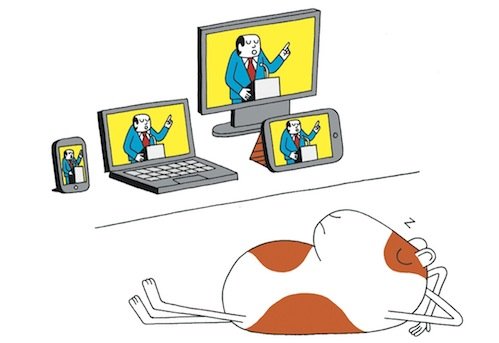Kanzler Werner Faymann startet dieser Tage auf Facebook. Hat unsere Politik überhaupt einen Plan im Netz?
“Werner Faymann isst gerade einen steirischen Apfel. Mmmmhhh“, “Werner Faymann sitzt neben Angela Merkel im Ausschuss. Mein Gott, die redet schon wieder so lang“, “Werner Faymann macht eine wichtige Durchsage: ‚Skisportlerinnen und Skisportler sind Vorbilder für die Jugend.‘ Hier der Link zur Pressemeldung“.
All das sind Statusmeldungen, die der Kanzler hoffentlich niemals verfassen wird. Kommende Woche legt Werner Faymann auf Facebook los. Am Nationalfeiertag starten sein Facebook-Auftritt, die dazugehörige Smartphone-App und die neue Webseite. 200.000 Euro kostet die Weboffensive des roten Regierungschefs angeblich. Das Bundeskanzleramt hält sich bedeckt, wie der Auftritt genau aussehen wird. Nur so viel sei verraten: Faymann wird nicht als Einziger auf seiner Fanseite Nachrichten verfassen. “Wir haben derzeit ein Team von sieben Leuten“, sagt Claus Hörr vom Bundespressedienst, “das Wichtigste ist Transparenz. Wenn der Kanzler selbst kommuniziert, tut er das in der Ich-Form. Wenn wer anders schreibt, dann schreibt er über Faymann in der dritten Person und mit eigenem Kürzel.“ So soll für Facebook-Fans jederzeit erkennbar sein, wer da wirklich hinter dem Computer sitzt.
Die Politik und das Web, eine schwierige Geschichte. Vor Wahlen lassen die Parteien noch schnell ein paar Webseiten und Blogs erstellen, nach der Abstimmung ist alles beim Alten: Funkstille. So war das in den letzten Jahren. Jetzt gibt es – vorsichtig formuliert – zumindest Indizien, dass sie das Web als politisches Schlachtfeld erkennen. Einerseits bietet es eine Bühne für Selbstdarstellung, andererseits lässt sich mit Netzthemen auch Politik machen.
Die SPÖ hat erst neulich ein Positionspapier herausgebracht, es ist zumindest der Start einer Diskussion im Parlamentsklub, bei der eine “Garantie der Netzfreiheit“, “Open Government Data“ und “den öffentlichen Rundfunk im Internet stärken“ angedacht wird. Gut klingende Schlagworte, die in der Praxis mit dem Koalitionspartner erst umgesetzt werden müssen. Oft sind es nur Einzelkämpfer, die sich für Netzpolitik einsetzen. Etwa Sonja Ablinger, die Kultursprecherin der SPÖ hat das Positionspapier mitentwickelt: “Auch wir sind ganz am Beginn, uns ganzheitlich zu positionieren.“
Wenn man bei den Parlamentsklubs anruft und nach jenem Abgeordneten verlangt, der sich für Netzpolitik einsetzt, hört man immer wieder: “Äh, keine Ahnung, wer das ist.“ Das liegt nicht nur daran, dass die digitale Agenda eine Querschnittsmaterie ist, bei der Sicherheitspolitik (Überwachung), Wirtschaftsinteressen (Urheberrecht), Infrastrukturfragen (Netzausbau) und Datenschutz (Web 2.0) hineinspielen. Das hat auch damit zu tun, dass viele Politiker noch gar nicht begreifen, wie massentauglich das Netz bereits ist.
Beispiel Facebook. Warum redet kein einziger österreichischer Politiker über das bedeutendste Netzwerk unserer Zeit? Immerhin sind dort mehr als 2,6 Millionen Österreicher angemeldet, sagt Facebook.
Die österreichische Technologiedebatte wird von der Sicherheitsdebatte überlagert. Da machen Law-and-Order-Politiker Überwachungsvorschläge, die Opposition schreit prompt auf und ortet Orwell’sche Machtgelüste. In dieser einseitigen Diskussion werden ganze Themenkomplexe übersehen, etwa der Konsumentenschutz.
Dabei könnte man mit Facebook gut Politik machen. Es ist massenwirksam, das zeigen die Userzahlen. Es gilt europäisches Recht, denn Facebook hat eine Tochterfirma in Irland und muss EU-Datenschutzbestimmungen einhalten. Bisher gelingt das nicht so recht. Der Kanzler will jetzt also facebooken. Noch besser wäre es, er würde auf die Rechte seiner Bürger auf Facebook pochen. In Deutschland gibt es solche Politiker: Die Verbraucherschutzministerin Ilse Aigner (CSU) hat aus Protest ihr Facebook-Profil gelöscht. Ein öffentlichkeitstauglicher Stunt, der auch die Debatte anregte.
Die Politik kann sehr wohl das Web formen. Sie gibt die Rahmenbedingungen vor, wie die Internetanbieter mit ihren Kunden umgehen dürfen. Eine der wichtigsten Forderungen ist jene der Netzneutralität. Netzneutralität schreibt Telekomfirmen vor, dass diese keine Daten und keine Internetdienste diskriminieren dürfen, damit kein Zweiklasseninternet entsteht. Wer viel zahlt, würde in einem solchen über den Informationshighway rasen und alle Onlinedienste konsumieren. Wer weniger Geld hat, müsste hingegen warten und dürfte nicht alle Services nutzen. Zum Beispiel würden viele Telefonieanbieter Skype gerne sperren oder Zusatzgebühren einheben, weil Skype hohe Datenmengen frisst und die Handyrechnung der Kunden verkleinert. Auch Telekom-Austria-Chef Hannes Ametsreiter sagte einmal zum Wall Street Journal: “Wenn jemand unsere Infrastruktur nutzt, um unsere Umsätze zu kannibalisieren, ergreifen wir natürlich Maßnahmen.“ Später relativierte die Telekom diese Aussage.
Die Politik könnte gesetzlich festschreiben, dass ein Zweiklassennetz gar nicht entstehen darf. Die Grünen haben einen entsprechenden Antrag im Frühjahr eingebracht, die SPÖ plädiert für dieses Konzept in ihrem Positionspapier, ÖVP-Technologiesprecherin Karin Hakl betont: “Ich bin für eine Gleichbehandlung von Webdiensten und Datenpaketen. Internetservice-Provider dürfen keine Inhaltskontrollen ausüben.“ Das BZÖ hängt der Idee grundsätzlich auch an. Nur die FPÖ ist etwas zurückhaltender und findet den derzeitigen Gesetzesentwurf ausreichend (siehe Rundruf bei den Parlamentariern, rechts).
Wenn SPÖ, ÖVP, Grüne und BZÖ für die Netzneutralität sind, warum ist die dann nicht längst Gesetz? Die schwarze Abgeordnete Hakl nennt zum Beispiel als Grund, dass man sich noch auf eine Definition von Netzneutralität einigen müsse.
Bitte warten, bitte weiterdiskutieren! Andere Länder sind schneller beim Fixieren von Userrechten: Das holländische Parlament führte heuer die Netzneutralität im Mobilfunk ein. Dort dürfen Telekomfirmen keine Zusatzgebühren einheben, wenn Kunden am Handy Skype benutzen. In Finnland gibt es seit 2010 ein Grundrecht auf Breitband. Jeder Bürger hat Anspruch auf einen Netzanschluss mit einem Megabit pro Sekunde. In Estland ist der Zugang zum Netz schon länger ein Bürgerrecht.
Mit digitalen Visionen spricht man nur eine Minderheit an, die technikaffinen Geeks. Dieses Kalkül schwingt natürlich mit. Dabei kann Netzpolitik ein Vekihel sein, um große gesellschaftspolitische Themen anzusprechen: Bürgerrechte, Transparenz, Mitbestimmung. Das zeigt die Piratenpartei. In Österreich sind die Piraten unauffällig, anderswo feiern sie Erfolge und sitzen schon im Europaparlament. Die schwedische Piratpartiet erzielte bei der Europawahl 2009 rund sieben Prozent und zog in Straßburg ein. Vergangenen September erreichten die Berliner Piraten 8,9 Prozent und landeten im Abgeordnetenhaus. Ein Aha-Erlebnis für die Politik. SPÖ-Abgeordnete Ablinger erzählt: “Der Erfolg der Piraten hat uns auch intern geholfen.“
Im Parlament, genauso wie in der Gesellschaft, herrscht eine digitale Kluft. “Ich kenne Parlamentarier, die nicht einmal wissen, wie man einen Computer einschaltet“, sagt Stefan Petzner, Mediensprecher des BZÖ.
In Österreich zeigt sich, dass gerade die Populisten im Netz die Masse ansprechen. Kein Politiker hat so viele Fans auf Facebook wie FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, 105.304 User drückten bisher auf “gefällt mir“. Daraufhin wurde eine Gegenseite gestartet, die heißt: “Kann dieser seelenlose Ziegelstein mehr Freunde haben als H.C. Strache?“ Derzeitige Fanzahl: 203.277. Im Netz gäbe es also auch Potenzial für Politiker, die der FPÖ widersprechen.
Ob Faymann Strache auf Facebook überholen wird? Das ist fraglich, auch der Bundespressedienst traut sich keine Prognose zu. “Das Entscheidende ist: Der Webauftritt muss einen Mehrwert gegenüber der normalen Medienberichterstattung darstellen“, sagt Politologe und Twitter-User Hubert Sickinger. Für Volksrepräsentanten ist es ein schwieriger Balanceakt, menschlich, aber nicht zu verblödelt zu wirken. Die Populisten mit ihrer Bierzeltrhetorik tun sich da leichter, Strache kann auf Facebook große Töne spucken, das ist man ohnehin gewohnt. Stefan Petzner postet online Fotos aus der Disco oder vom Haustier.
Anderen graut vor diesem Gedanken, zum Beispiel dem Grünen Albert Steinhauser. Der twittert und bloggt, bleibt aber ernst. “Mich haben schon Leute angesprochen, warum ich nicht mehr Privates schreibe“, sagt er, “aber viele Politiker sind aus guten Gründen nicht im Kabarett gelandet. Je lustiger man wird, desto peinlicher kann es auch werden.“
Weil es noch wenig Erfahrungswerte gibt, ist gute Webkommunikation eine Kunst. Jede Community hat ihre Regeln. Facebook ist größer und gesellschaftlich breiter als andere Netzwerke. Twitter ist eine Nische, in der sich hochinformierte politik- und mediennahe User finden. “Facebook und Twitter haben ein völlig unterschiedliches Publikum“, sagt Stefan Petzner, “Facebook ist die Kronen Zeitung des Internets, Twitter ist der Falter.“ Zu dieser Logik passt die Webstrategie des Kanzlers: Der wird sich auf Facebook konzentrieren, Twitter ist nur ein Begleitmedium, um Geschichten anzukündigen. Krone vor Falter, Facebook vor Twitter, manche Dinge bleiben auch im Netz gleich.
Dieser Artikel ist im Falter (Ausgabe 42/11) erschienen. Illustration: Jochen Schievink