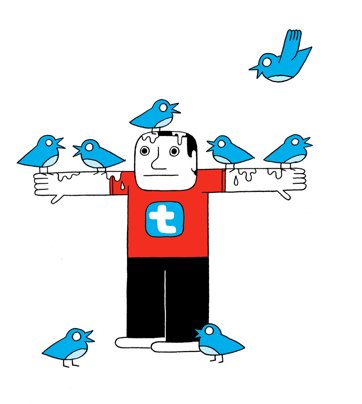Ein Aufstand im Iran, ein Moonwalk am Karlsplatz oder ein beiläufiger Gedanke der Nachbarin: Twitter.com macht süchtig und verändert die Gesellschaft.
Die deutsche Userin „wortkomplex“ ist neidig: „Nachbarskinder haben ein Planschbecken. Ich nur Kaffee.“ Ihre amerikanische Twitter-Kollegin „worksplay“ zitiert ein Michael-Jackson-Lied: „Heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race.“ Und im Iran schreibt „oxfordgirl“: „Reasons to remove regime: 160 children under age of 16 on death row.“ Von Alltagsbeobachtungen bis zu politischen Forderungen. All das trudelt zur selben Zeit auf Twitter.com ein.
Twitter ist wie eine Droge. Es macht süchtig, und man versteht den Reiz erst, wenn man es selbst ausprobiert hat.
Auf den ersten Blick wirkt die Idee ziemlich banal: Menschen melden sich online an, um Kurznachrichten mit maximal 140 Zeichen zu verfassen. „Was machst du gerade?“, fragt das Eingabefeld. Mancher Benutzer antwortet treuherzig, dass er momentan am Bahnhof sitzt, ein Wurstsemmerl isst oder zum Donauinselfest fährt. Andere nutzen das Service, um interessante Zeitungsartikel oder Webseiten zu empfehlen. „Microblogging“ nennen sich diese Aktivitäten. Ob die Menschheit solche Infohäppchen tatsächlich braucht? Bis vor kurzem gab es daran große Zweifel.
Dann fanden die Wahlen im Iran statt. Plötzlich ließ sich nicht mehr leugnen, dass sich Twitter für politische Mobilisierung und Berichterstattung aus dem Untergrund eignet. In Teheran tauscht sich die Protestbewegung über Onlinedienste wie diesen aus. Die sogenannten Tweets mit bis zu 140 Zeichen sind lang genug für das Wesentliche. „Bestätigt: heute, fünf Uhr nachmittags, Vali-Asr-Platz. Unterstützer der Freiheit trägt Schwarz, um den Gefallenen Tribut zu zollen“, schreibt der eine. Und ein anderer sagt: „Razzia gegen Journalisten: Berichten zufolge wurden Journalisten in Boushehr, Mashad und Rasht verhaftet.“
Warum eignet sich Twitter so gut zum Mobilisieren? Was gefällt den Usern daran? Ist diese Kommunikation wirklich so revolutionär?
Schuld an dem ganzen Gezwitscher (das bedeutet Twitter im Englischen) sind der Programmierer Jack Dorsey, der Grafiker Biz Stone und Evan Williams, der kaufmännische Kopf. Die drei gründeten Twitter 2006 – aus einer Notlage heraus. Ihr damaliges Start-up-Unternehmen Odeo lief nicht gut. Man brainstormte über neue Geschäftsideen. Und da kam Dorsey mit dem entscheidenden Vorschlag auf: Wie wäre ein Onlineservice, bei dem man anderen mitteilt, was man gerade macht? So könnte man zum Beispiel dem Freundeskreis sagen, wo gerade eine heiße Party steigt.
Von ihrem internettauglichem Handy oder dem Computer am Arbeitsplatz loggen sich auch österreichische Mitglieder ein. Viele stammen aus der Onlinecommunity, sind Studenten oder haben Jobs, bei denen sie am PC sitzen. Jetzt können sie jede Wartezeit auch noch mit Mininachrichten überbrücken. 37 Millionen Menschen riefen weltweit im Mai 2009 Twitter.com auf, sagt Marktforscher ComScore.
In den USA ist das Portal nun die drittgrößte Social-Networking-Plattform nach den Freundschaftsportalen Facebook und MySpace. Schauspieler Ashton Kutcher hat mehr als 2,5 Millionen „Follower“ – das sind Twitter-User, die seine Beiträge abonnieren. Und auch Startalkerin Oprah Winfrey stieg im Frühjahr ein. Ihre erste Nachricht an die Community: „FEELING REALLY 21st CENTURY.“ Ob solche Promis wirklich selbst hinter der Tastatur sitzen und ob man dadurch Oprah tatsächlich näher kommt, ist eine andere Frage.
Die User schätzen an der Seite, „dass man bei Fragen fast immer Antworten bekommt. Und zwar gute Antworten!!“, schreibt Mitglied „SonjaSchiff“. „Ich mag die knackigen Infohappen. Bei Interesse klick ich einfach auf den dazugehörigen Link, um mich näher zu informieren“, sagt „afredd“. „Twittern ist wie im Kaffeehaus sitzen und mit Freunden und Kollegen über Interessantes und Belangloses reden“, meint „cschlemmer“. Und das sind nur ein paar der Antworten, die man erhält, wenn man mitzwitschert.
Das Potenzial als Mobilisierungstool endet nicht mit dem amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf oder den Demos in Teheran. Vergangene Woche sammelten sich plötzlich einige dutzend Wiener am Karlsplatz. Es war keine politische Protestaktion, sondern ein spontaner Aufmarsch von Michael-Jackson-Fans. Auf Twitter.com kam die Idee eines Massen-Moonwalks auf, sie wurde schnell zirkuliert. „Heute 18/19h Karlsplatz. Kriegen wir den Massmoonwalk hin?“, schrieb zum Beispiel Mitinitiator und Gap-Herausgeber Niko Alm.
Waren dann 100 oder sogar 200 Menschen am Karlsplatz? Das ist nicht wichtig. Viel entscheidender ist, dass plötzlich so ein schräges, spontanes Event stattfindet: Die Menge baute ein Soundsystem auf, tanzte zu Michael-Jackson-Platten, und ein paar Verrückte stiegen bekleidet in den Teich.
Die Proteste in Teheran und der Spaß-Flashmob in Wien nutzen dieselbe Infrastruktur. Twitter kann man sich wie einen riesigen, rauschenden Informationsfluss vorstellen. Egal, ob in New York ein Flugzeug im Hudson River landet oder in China ein Sack Reis umfällt, hier ist es nachzulesen. Und weil die Benutzer Twitter nach Stichworten durchsuchen können und spannende Texte besonders schnell an andere User weitergeleitet werden, ist Twitter oft schneller als CNN oder Onlinezeitungen.
Manchmal sind die Tweets auch falsch. Absurd zu glauben, es wäre anders. „Die Stärke von Twitter, dass so viel Information über den Kanal geht, ist gleichzeitig auch die Schattenseite“, sagt Wolfgang Reinhardt, Informatiker an der Uni Paderborn. Wer nicht im Rauschen untergehen will, muss lernen, aus der Flut an Informationen richtig zu selektieren: Will man eine Scheinnähe zu Promis aufbauen, dann empfiehlt sich ein Blick auf den Account von Demi Moore. Möchte man über Neuigkeiten im Web informiert sein? Da kann man beim New York Times-Technikkolumnisten David Pogue mitlesen. Und wen beides langweilt, der kann so schrille Kunstfiguren wie den Taubenvergrämer verfolgen.

Ein besonders populärer User ist hierzulande Armin Wolf. Mehr als 5700 Mitglieder lesen mit, was der ORF-Journalist erzählt. Vor Interviews holt er sich gerne Anregungen aus der Community. „Ich bin auf Twitter gekommen, weil ich mir dachte: Die ‚ZiB 2‘ sollte auch Zugang zu Menschen bekommen, die wir nicht übers Fernsehen erreichen“, sagt Wolf. Das zeigt, wie klassische Medien merken, dass die alte Medienhierarchie Fernsehen – Radio – Zeitung aufbricht.
Twitter wächst rasant. In Österreich besuchten im Mai 2008 gerade einmal 1000 Menschen die Webseite. Ein Jahr später waren es laut ComScore 94.000. Es ist ein typisches Web-2.0-Schicksal, dass die Seite noch keinen einzigen Cent eingenommen hat. Erst im Februar trieb Twitter weitere 35 Millionen Dollar von Investoren auf – insgesamt stecken in der Firma 55 Millionen Dollar. Das ist Risikokapital von Unternehmen wie Benchmark Capital und Institutional Venture Partners. Sie streben riesige Gewinne an. Zum Vergleich: Das Videoportal YouTube wurde für 1,65 Milliarden Euro an Google verkauft.
Mittlerweile ist man in der Branche vorsichtiger geworden. Denn der Ansturm der User lässt sich nicht so leicht in Bares verwandeln. Heuer möchte Twitter erstmals mit dem Geldverdienen beginnen. Dann könnten Firmen wie der Computerhersteller Dell oder die Coffeeshop-Kette Starbucks für ihre Mitgliedschaft zahlen. Kein Wunder: Dell hat erst kürzlich bekanntgegeben, dass es mittels Marketingmaßnahmen auf Twitter drei Millionen Dollar umgesetzt hat.
Selbst für den Fall, dass Twitter insolvent wird, geht es nicht so sehr darum, welcher Anbieter sich durchsetzt. Sondern darum, dass Menschen einen neuen Kommunikationsdrang entdeckt haben, von dem sie bis vor kurzem nichts wussten.
Das zeigte auch der vergangene Donnerstag. Da brach Twitter zwischenzeitlich unter dem Ansturm an Usern zusammen. Wieder einmal erschien der „Fail Whale“ – dieses Logo symbolisiert, dass Twitter gerade überlastet ist. Zu viele Menschen wollten gleichzeitig über den Tod des „King of Pop“ nachlesen oder Abschied nehmen. Binnen einer Stunde trafen mehr als hunderttausend Kurzkommentare auf der Online-Plattform ein.
Als John F. Kennedy 1963 erschossen wurde, standen viele Menschen fassungslos vor den Fernsehapparaten. Als Lady Diana 1997 bei einem Autounfall ums Leben kam, lief CNN, und man rief sich gegenseitig am Handy an. Von Michael Jacksons Tod erfuhren viele im Netz. Oder sie strömten dann nachträglich ins Web. Egal, ob die Firma Twitter heißt oder nicht. Dieses neue Informations- und Mitteilungsbedürfnis ist nicht mehr wegzubekommen.
Weiterführende Links:
– Diese Twitter-Autoren sollte man zu Recht online verfolgen
– Wie mache ich da mit? Eine kurze Einstiegshilfe für Twitter